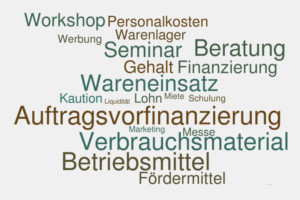Know-how - Die 12 häufigsten Fehler bei der Unternehmensfinanzierung (#11 von 12)
Es ist ein Allgemeinplatz: Gute Bankbeziehungen sind für Unternehmen essentiell wichtig. Trotzdem ist nicht jeder Geschäftsführung klar, was das eigentlich heißt, wie sie sich herstellen lassen und wofür genau das von Vorteil ist.
 ©Konstantin Yuganov, Fotolia.com |
| Finanzierungspartner brauchen ein Bild von der gemeinsamen Zukunft. |
Sporadischer Kontakt zur Bank
Im Bedarfsfall: Kontakt – so ließe sich die Einstellung vieler Unternehmen zu ihren Banken auf den Punkt bringen. Dieses Verhalten mag als Unsitte oder Unhöflichkeit verharmlost werden, tatsächlich verbinden sich damit aber ernsthafte Nachteile für die Unternehmensfinanzierung.
Kaum eine Geschäftsführung entwickelt von heute auf morgen die Idee, in neue Maschinen zu investieren, endlich einen Anbau für die Werkshalle umzusetzen, die Digitalisierung anzugehen oder mit der Übernahme eines Mitbewerbers eine größere Marktpräsenz zu erwirken. Hier werden Gedanken behutsam entwickelt, aufgebaut und gepflegt. Für die Informationspolitik gegenüber der Bank gilt eine solche Umsicht scheinbar nicht. Erst wenn sich die Gelegenheit als günstig erweist, suchen viele Unternehmen den Kontakt zu ihrem Ansprechpartner in der Bank.
Unternehmenskultur: Trau, schau, wem!
Die Mitarbeiter in der Bank fallen angesichts größerer Investitionssummen dann nicht selten aus allen Wolken. Noch vor jedem Rating stellt sich hier die Frage der persönlichen Einordnung: Was ist das für ein Unternehmen, wie wurde und wird es geführt, welche Entwicklung hat es in den letzten Jahren genommen? Auch der Unternehmerpersönlichkeit kommt auf der sozialen Ebene zentrale Bedeutung zu: Setzt sich die Geschäftsführung realistische Ziele, plant sie solide und ist sie in der Lage, eine passende Umsetzung zu organisieren?
Schnell zeigt sich, die Antworten lassen sich nicht in den Akten und auch nicht in den vorgelegten Zahlen finden. Fehlt jeglicher Kontext, wird es schwierig, die Erfolgsaussichten des Vorhabens einzustufen. Erste Irritationen stehen dann bereits im Raum, die mit einer anderen Unternehmenskultur zu vermeiden gewesen wären.
Wie Unternehmen gute Bankbeziehungen herstellen
Anstatt auf einen Sachbearbeiter zu hoffen, der die Versäumnisse einer brachliegenden Informationspolitik nachsieht, kann das Management die Bankbeziehungen bereits im Vorfeld proaktiv gestalten. Das beginnt manchmal schon mit einem Umdenken: Unternehmen sollten ihre Banken weniger als abrufbereite Dienstleister und mehr als Finanzierungspartner verstehen. Um diese von einer gemeinsamen Zukunft zu überzeugen, braucht es Zeit und Vorbereitung.
Das Mittel der Wahl sind periodisch wiederkehrende Bankgespräche. Für Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung sind solche Termine ohnehin vorgeschrieben und machen auch einen Teil ihres Ratings aus. Es spricht einiges dafür, dass auch kleine und mittlere Unternehmen solche Sitzungen fest in ihre Unternehmenskultur integrieren.
Mindestens einmal pro Jahr sollte die Geschäftsführung einen Termin mit ihrem Ansprechpartner in der Bank vereinbaren und zunächst die Themen Bilanz und Jahresabschluss auf die Agenda setzen. Das bedeutet nicht, das Zahlenwerk bloß rechtzeitig einzureichen. Vielmehr sollte das Management betriebswirtschaftliche Abrechnungen und Jahresabschlüsse auch ausführlich besprechen und dabei in den Rahmen der gesamten unternehmerischen Entwicklung rücken.
Worum es in Bankgesprächen geht
Am besten lassen sich solche Termine mit Mitarbeiterjahresgesprächen in großen Unternehmen vergleichen: Welche Meilensteine wurden seit dem letzten Treffen erreicht und warum diese oder jene nicht? Und vor allem: Wo geht die unternehmerische Reise hin?
Gerade das Zahlenmaterial eignet sich als feste Basis für eine Leistungsschau der unternehmerischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. An dieser Stelle bedarf es daher einer realistischen Einschätzung mit einem Hauch von Understatement. Beurteilt das Management die Entwicklung allzu euphorisch, fällt das schnell auf es selbst zurück, da die verlauteten Ziele des einen Gesprächs immer die Ausgangslage für das nachfolgende bilden. Kann das Unternehmen dann nicht einmal die Hälfte der Versprechungen einhalten, sendet es deutliche Signale an die Bank: Dieses Unternehmen kann nicht planen.
Dieser Eindruck wird auch erweckt, wenn die prognostizierten Ergebnisse deutlich überboten werden. Signifikante Fehlkalkulationen in den positiven Bereich passen nicht zu einer Planung, die die Unternehmensrealität in den Griff bekommen will. Der Schluss liegt nahe, dass dieses Controlling-Defizit sich in Zukunft ebenso negativ auswirken kann.
Punktgenaue Landungen wirken dagegen wesentlich überzeugender. Positive Abweichungen bis zu 20 % liegen durchaus noch im Toleranzbereich. Im Fall unkontrollierter Ausschläge im noch höheren Bereich muss das Management aber die Ursachen im Bankgespräch aufarbeiten und diese Erkenntnisse in die neue Planung integrieren. Nur in den wenigsten Fällen, wie etwa bei unvorhersehbaren (Umwelt)Einflüssen, liegt die Verantwortung für Fehlplanungen nicht bei der Unternehmensführung. Allerdings kann die Geschäftsführung auch hier erörtern, wie auf solche Situationen reagiert werden kann, beispielsweise mit einer Diversifizierung des Produktportfolios.
Im Vorfeld der Unternehmensfinanzierung
Für den Ausblick in die unternehmerische Zukunft reicht ein Forecast für das kommende Jahr in der Regel aus. Hier darf das Management auch den großen Bogen schlagen und die Leitideen der Unternehmenspolitik für die kommenden 3 Jahre darstellen. Aber Achtung: Alles, was darüber hinausgeht, ist Kaffeesatzlesen und kann schnell im Bereich Wolkenkuckucksheim verortet werden.
Die Unternehmensführung sollte ihren Finanzierungspartnern daher nicht jeden Schnellschuss als aussichtsreiches Projekt präsentieren. Als Faustregel gilt: Es werden nur diejenigen Vorhaben angesprochen, die zu den wirklichen Pfeilern der künftigen Unternehmenspolitik zählen und mit Sicherheit in den kommenden 12 bis 36 Monaten umgesetzt werden. Der Rest ist Fingerspitzengefühl: Wie viel weiterführendes Potenzial muss das Management vorbringen, um die Bank zu überzeugen?
Auch Verkäufe oder Schließungen von hauseigenen Niederlassungen sind Vorhaben, die dringend an die Bank weitergegeben werden sollten. Beschäftigt sich das Führungspersonal etwa mit dem Gedanken eine Filiale zu verkaufen, muss abgeklärt sein, ob die Finanzierung bereits ausgelaufen ist. Außerdem könnte es für einige Irritationen sorgen, wenn die Bank nicht von dem Unternehmen, sondern von einem Interessenten über den Verkauf der Filiale in Kenntnis gesetzt wird.
Damit eignen sich Banktermine hervorragend dafür, Investitionsvorhaben bereits im Vorfeld strategisch anzukündigen. Manchmal führen die Gespräche auch direkt in erste Finanzierungsverhandlungen. Professionell vorbereitete Unternehmen können hier mit gut aufbereiteten Unterlagen punkten.
Die Geschäftsführung sollte sich aber nicht davon verunsichern lassen, dass manch motivierter Mitarbeiter auch schon nach Planzahlen oder Angeboten zu Investitionsvorhaben verlangt, die erst weit in der Zukunft angesiedelt sind. Um doppelten Aufwand zu vermeiden, darf das Management hier gerne darauf vertrösten, dass ein passendes Zahlenwerk zu geeigneter Stunde vorgelegt wird.
In guten wie in schlechten Zeiten: Vorteile vertrauensvoller Bankbeziehungen
Unternehmen können Bankgespräche als Chance nutzen, sich ihren Finanzierungspartnern als professionelle Planer zu präsentieren. Werden die Gespräche über Jahre hinweg mit Sorgfalt gepflegt und entsprechend angegangen, schafft das Vertrauen bei der Bank. Die Ansprechpartner fühlen sich damit in die unternehmerische Entwicklung einbezogen und müssen weder zur Zukunft noch zu vergangenen Ergebnissen Rückfragen stellen.
Gerade wenn das Unternehmen in Bankgesprächen überzeugt, erhält das Wort des Managements deutlich mehr Gewicht. Das bleibt nicht ohne Einfluss auf mögliche Finanzierungsverhandlungen. Kündigt das Unternehmen ein kostenintensives Innovationsvorhaben mit den Worten an, dieses werde wie ein Quantensprung funktionieren, werden die Entscheider in der Bank der Aussage weit mehr Gehör schenken, wenn sich das Management in Planungsfragen bislang als treffsicher und solide erwiesen hat.
Aber auch für den Fall, dass ein Unternehmen in Notlagen und Schwierigkeiten gerät, kann es rechtzeitige Krisengespräche auf einer ganz anderen Grundlage führen. Salopp formuliert: Im Fall von Fehlentwicklungen sitzt der Banker gewissermaßen mit im Boot, bei Investitionen wird er hingegen geneigt sein, dem Management eher das Vertrauen auszusprechen.
Ein solches Vorgehen empfiehlt sich selbst dann, wenn die Chemie zwischen Bankmitarbeiter und Unternehmensführung nicht ganz passt. Jedes Bankgespräch wird samt erklärender Notizen aktenkundig aufbewahrt. Stehen wichtige Entscheidungen im Raum, insbesondere wenn der Sachbearbeiter in der Bank wechselt, ist zweifelsfrei erkennbar, dass das Unternehmen stets auf umsichtiges, transparentes und professionelles Verhalten gesetzt hat.